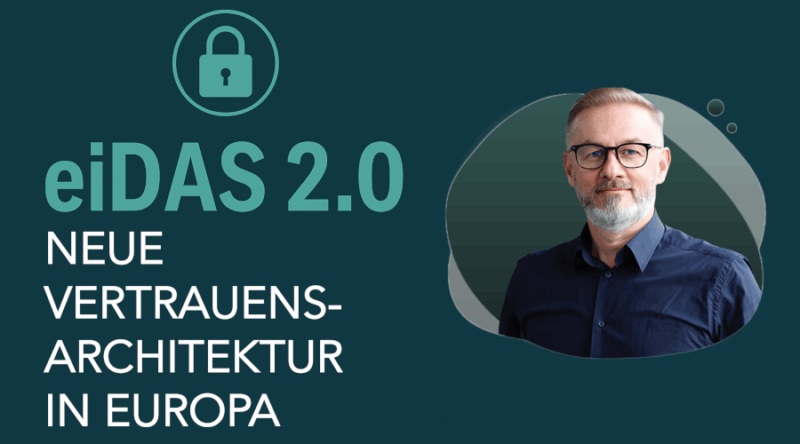
Die Veröffentlichung von sechs Durchführungsrechtsakten zur eIDAS-Verordnung im Oktober 2025 stellt einen Wendepunkt für den europäischen Markt für Vertrauensdienste dar. Die neuen Anforderungen eröffnen Chancen, stellen aber auch erhebliche operative Herausforderungen dar. Die Stärke liegt natürlich nicht in den Vorschriften selbst, sondern in den praktischen Geschäftsentscheidungen, die Unternehmen treffen müssen, um in einer einheitlichen europäischen Digitalwirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Bevor ich jedoch beschreibe, was dies für Unternehmen bedeutet, hier einige wichtige Fakten:
- Die neuen Rechtsakte standardisieren Verfahren zur Identitätsprüfung,
- die Verwaltung von Fernsignaturgeräten,
- elektronische Archivierungsdienste und Aufsichtsverfahren.
Klingt technisch? Ja. Aber praktisch bedeutet es vor allem eines: Unternehmen können nicht mehr nach lokalen Regeln spielen. Jetzt gilt ein einheitliches europäisches Spiel.
Compliance als tatsächlicher Wettbewerbsvorteil.
In den DACH-Ländern war die Einhaltung europäischer Normen schon immer der Weg zum Markteintritt, aber jetzt ist sie praktisch zu einem Wettbewerbsvorteil geworden.
Warum? Weil eine in Polen ausgestellte Signatur nun automatisch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ohne zusätzliche Verfahren anerkannt wird … und umgekehrt natürlich auch. Das bedeutet einen einfacheren Vertriebsweg für polnische Unternehmen. Anstatt lokale Ausnahmen auszuhandeln, kann eine Standardlösung angeboten werden, die überall in der Union den Anforderungen entspricht.
Im Finanzsektor ist dieser Effekt noch stärker. Banken und FinTechs, die ihre Identitätsprüfungsprozesse modernisieren, können die Onboarding-Zeit von Tagen auf Stunden verkürzen – bei höherer regulatorischer Sicherheit. Für polnische Unternehmen bedeutet dies: Investition in Compliance jetzt = deutlich niedrigere Betriebskosten in ein oder zwei Jahren.
Trust as a Service – ein neuer Markt mit einem Wert von mehreren Milliarden.
Die neuen Vorschriften eröffnen ein völlig neues Geschäftsfeld: Validierungsdienste, Verwaltung von Fernsignaturgeräten, elektronische Zustellung und Langzeitarchivierung. Bislang wurden die meisten dieser Dienste ausschließlich von großen internationalen Unternehmen angeboten.
Durch die Standardisierung der Anforderungen können nun auch polnische Unternehmen mit entsprechendem technischen Know-how zu gleichen Bedingungen mit Akteuren aus Deutschland oder Österreich konkurrieren.
Besonders vielversprechend ist der Markt für elektronische Archivierung. Das neue Gesetz führt qualifizierte elektronische Archivierungsdienste ein, die eine langfristige Aufbewahrung von Daten ohne das Risiko eines Integritätsverlusts garantieren. Dies bedeutet eine enorme Nachfrage nach Unternehmen, die Kenntnisse in den Bereichen Archivierung, Kryptografie und Lebenszyklusmanagement digitaler Daten miteinander verbinden können.
Das Problem der Interoperabilität stellt eine echte technische und organisatorische Herausforderung dar.
Theoretisch gelten in Europa einheitliche Standards. In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen verschiedene Varianten der Identitätsprüfung implementieren müssen: vollautomatische Verfahren (mit NFC-Lesegerät), hybride Verfahren mit menschlicher Überprüfung (Video + Experte) und Fernverfahren.
Für einige Unternehmen, die KYC-Dienstleistungen anbieten, bedeutet dies eine radikale Veränderung ihrer Betriebskosten. Konnten sie bisher die Überprüfung unter flexibleren Bedingungen durchführen, müssen sie nun ein höheres Maß an Identitätssicherheit erreichen, was entweder Investitionen in Technologie oder in geschulte Experten für die Überprüfung erfordert.
Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die in die DACH-Region expandieren: Der deutsche Markt war bisher in Bezug auf die digitale Identität am besten reguliert, jetzt müssen sich alle Länder auf einen einheitlichen Standard einigen. Die Übergangsphase ist eine Chance – Unternehmen, die den neuen Standard proaktiv umsetzen, werden weniger Zeitdruck und geringere Kosten haben.
E-Rechnungen – konkrete Fristen.
In Deutschland ist die Situation klar: Ab dem 1. Januar 2025 muss jedes Unternehmen in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen; ab dem 1. Januar 2027 müssen Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 800.000 Euro elektronische Rechnungen ausstellen; ab dem 1. Januar 2028 gilt diese Verpflichtung für alle Unternehmen.
Diese Regelung knüpft direkt an die neuen europäischen Standards an. Für polnische Unternehmen, die Kunden in Deutschland bedienen (insbesondere für Anbieter von ERP-Software oder Finanz- und Buchhaltungssystemen), bedeutet dies: Jeder neue Kunde in Deutschland wird Unterstützung für die elektronische Rechnungsstellung erwarten.
Die am stärksten betroffenen Sektoren: Wo sollten Compliance-Ressourcen investiert werden?
Finanzsektor – Transformation auf ganzer Linie.
Banken und Versicherungsgesellschaften in Polen und der DACH-Region müssen ihre Identitätsprüfungsprozesse auf der Grundlage neuer Standards umgestalten. Dies betrifft nicht nur die Verfahren, sondern auch die Systemintegration mit neuen Vertrauensdienstleistern und die Anpassung mobiler Anwendungen an die Nutzung des europäischen digitalen Identitätsportfolios.
Für polnische Banken, die nach Deutschland und Österreich expandieren, bedeutet dies, dass sie keine lokalen, vereinfachten Verfahren mehr anwenden können. Jeder neue Kunde in Deutschland erfordert ein höheres Maß an Überprüfung, was höhere Überprüfungskosten, aber auch eine höhere regulatorische Sicherheit bedeutet. Paradoxerweise kann diese Standardisierung die Gesamtkosten für die Compliance auf Ebene der Bankengruppe senken.
Der öffentliche Sektor – ein neuer Bereich für digitale Dienste.
Gemeinden, Städte und zentrale Behörden müssen sich in das europäische digitale Identitätsportfolio integrieren, damit sie qualifizierte Attributbescheinigungen ausstellen können – beispielsweise Schulzeugnisse, Diplome oder Berufsqualifikationen.
Für Unternehmen, die E-Government-Lösungen anbieten, bedeutet dies ein neues Geschäftsfeld: Schnittstellen für die Ausstellung solcher Bescheinigungen, Backends für die Verwaltung des Lebenszyklus von Zertifikaten, Systeme zur Validierung und zum Widerruf.
Versicherungsbranche – Automatisierung der Dokumentation und Überprüfung.
Versicherer müssen elektronische Signaturen und Siegel in ihre Prozesse für Schadenbearbeitung, Underwriting und Compliance integrieren. Die neuen Standards ermöglichen die automatische Überprüfung von Dokumenten, die von Maklern, Vertretern und Kunden stammen, ohne dass eine manuelle Validierung erforderlich ist. Dies verändert die Betriebskosten und die Verarbeitungsgeschwindigkeit erheblich.
Von der Theorie zur konkreten Umsetzung.
Regulatorische Asymmetrie: Polen gegen Deutschland
Für polnische Technologie-, Finanz- und Versicherungsunternehmen bedeutet dies konkrete Herausforderungen – und Chancen:
Dringende Überprüfung der Compliance: Die neuen Durchführungsbestimmungen eIDAS 2.0 legen detaillierte technische Anforderungen für Signaturen, Siegel, Zustellungen und Validierungen fest. Unternehmen müssen so schnell wie möglich überprüfen, ob ihre aktuellen Lösungen und Prozesse den neuen ETSI-Standards und Qualifikationsanforderungen entsprechen. Fehlende aktuelle Zertifikate oder mangelnde Konformität können bald zum Ausschluss von Ausschreibungen oder Projekten für den öffentlichen Sektor führen – insbesondere in den DACH-Ländern, wo der Standard „compliant by design” eine Markterwartung und kein Wettbewerbsvorteil ist.
Investitionen in Zertifizierungen und Audits: Technologische Glaubwürdigkeit wird mittlerweile genauso wichtig wie Funktionalität. Unternehmen sollten sich auf Audits zur Einhaltung von eIDAS, NIS2 und DORA vorbereiten und in qualifizierte Zertifikate und Sicherheitsbescheinigungen investieren. Im Zeitraum 2025-2027 wird die Zertifizierung nicht nur eine formale Anforderung sein, sondern auch eine Vertrauenswährung – entscheidend dafür, wer zur Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und der öffentlichen Verwaltung zugelassen wird.
Aufbau eines Partner-Ökosystems: Die Ära der isolierten Anbieter neigt sich dem Ende zu. eIDAS 2.0 belohnt in der Praxis Interoperabilität und Zusammenarbeit – daher sollten Unternehmen damit beginnen, Partnerschaften mit Vertrauensdienstleistern, Integratoren, Compliance-Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufzubauen. Durch Zusammenarbeit kann schneller auf regulatorische Änderungen reagiert, die Kosten für die Umsetzung geteilt und integrierte grenzüberschreitende Angebote geschaffen werden, die bessere Chancen haben, in die DACH-Märkte einzutreten.
Fokus auf Nischen und unterversorgte Sektoren: Anstatt mit den größten Akteuren zu konkurrieren, lohnt es sich, sich auf Mikrosegmente zu konzentrieren, in denen Vertrauen und Compliance entscheidend sind, aber keine passenden Lösungen vorhanden sind. Dazu gehören unter anderem das Segment der Krankenversicherungen, KMU im Finanzbereich, ESG-Audits, Datenzertifizierung und elektronische Zustellungen im öffentlichen Sektor.
Genau dort werden neue Marktzugänge für polnische Unternehmen entstehen, die Agilität mit Sicherheit verbinden können.
Vorbereitung auf die Übergangsphase (2025-2027): Dies ist ein dreijähriges „Zeitfenster”, in dem sich der Markt erst stabilisieren wird. Unternehmen mit Teams für Compliance, Audit und Regulierung werden in dieser Zeit zur besten Quelle für Einnahmen und Exportkompetenzen werden – insbesondere in den Beziehungen zu Partnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Für deutsche Unternehmen bedeuten eIDAS 2.0 und KSeF konkrete Herausforderungen – und reale Chancen für den Eintritt in den polnischen Markt:
Fintech-Sektor und ERP-Software: Für deutsche Anbieter von Finanzlösungen, ERP- und Geschäftsprozessautomatisierungslösungen ist die Unterstützung von KSeF nicht mehr optional – sie ist eine Voraussetzung für den Eintritt in den polnischen B2B-Markt. Ab dem 1. April 2026 sind alle polnischen Unternehmen verpflichtet, das nationale E-Rechnungssystem zu nutzen. Das bedeutet, dass jeder Anbieter von Finanzsoftware, der in Polen präsent sein möchte, eine automatische Integration in dieses System ermöglichen muss. Derzeit verfügen nur 44 % der polnischen Unternehmen über Buchhaltungssysteme, die Rechnungen automatisch aus dem KSeF abrufen können, und nur ein Drittel kann diese Daten ohne menschliches Zutun mit der Lagerdokumentation oder Bestellungen verknüpfen.
Dies ist eine enorme Marktlücke – ein ideales Feld für deutsche Unternehmen, die integrierte End-to-End-Lösungen anbieten können, die ERP, Zahlungen, Workflow und Compliance in einem Ökosystem vereinen.
Versicherungs- und Zahlungssektor: In den kommenden Monaten wird der polnische Versicherungs- und Finanzmarkt vor der Herausforderung stehen, sich in das KSeF zu integrieren und die vollständige Konformität mit eIDAS 2.0 zu erreichen. Für deutsche Insurtechs, Zahlungsdienstleister und RegTech-Unternehmen ist dies der richtige Zeitpunkt, um Technologien anzubieten, die auf qualifizierten elektronischen Signaturen und Siegeln basieren und mit KSeF und europäischen Standards kompatibel sind.
Bis zum 1. Februar 2026 müssen alle Finanzinstitute in Polen solche Lösungen implementieren – sowohl in internen Prozessen als auch in B2B-Beziehungen mit Kunden. Eine mangelnde Unterstützung in diesem Bereich kann zu Vertragsverlusten und einem Reputationsverlust führen – bereits jetzt erklären mehr als 50 % der polnischen Unternehmer ihre Bereitschaft, zu einem Anbieter zu wechseln, der die Anforderungen von KSeF erfüllt.
Für deutsche Unternehmen ist dies nicht nur eine Frage des Produkts, sondern auch eine Chance, europäische Qualitäts- und Vertrauensstandards in einem schnell reifenden Markt einzuführen.
Technische und organisatorische Herausforderungen – und eine Chance für Beratungsunternehmen: Das größte Hindernis in Polen ist nicht die Technologie, sondern die Kompetenz und Organisation der Implementierung. Über 48 % der polnischen Unternehmen geben den Mangel an KSeF-Experten als Haupthindernis an, und 53 % nennen die Notwendigkeit, die Buchhaltungsprozesse in ERP-Systemen anzupassen, als größte technische Herausforderung. Dies eröffnet deutschen Anbietern und Beratungspartnern neue Möglichkeiten – insbesondere denen, die Erfahrung in der Prozessautomatisierung mit lokalen Kenntnissen über polnische Vorschriften, XML-Strukturen und Rechnungsstellungsstandards verbinden können.
Unternehmen, die in lokale Teams, Implementierungszentren oder Partnerschaften mit polnischen Integratoren investieren, werden sich als vertrauenswürdige Technologiepartner auf einem Markt positionieren, der 2026–2027 zu den am schnellsten wachsenden in der EU gehören wird.
In der Praxis: Für deutsche Unternehmen sind eIDAS 2.0 und KSeF nicht nur regulatorische Verpflichtungen, sondern ein strategischer Moment für den Einstieg in das Ökosystem der digitalen Vertrauensdienste in Polen. Diejenigen, die den lokalen Kontext verstehen und Lösungen anbieten können, die Technologie und Compliance verbinden, werden zu natürlichen Partnern für polnische Finanz-, Versicherungs- und öffentliche Einrichtungen.
Das ist genau der Moment, von dem Sie in dem zitierten Text gesprochen haben: Die Zukunft der digitalen Wirtschaft gehört denen, die Vertrauen aufbauen können, das auf Fakten, Standards und Zusammenarbeit basiert – nicht auf Erklärungen. Sechs Durchführungsrechtsakte vom Oktober 2025 geben polnischen Unternehmen einen präzisen Fahrplan vor.
